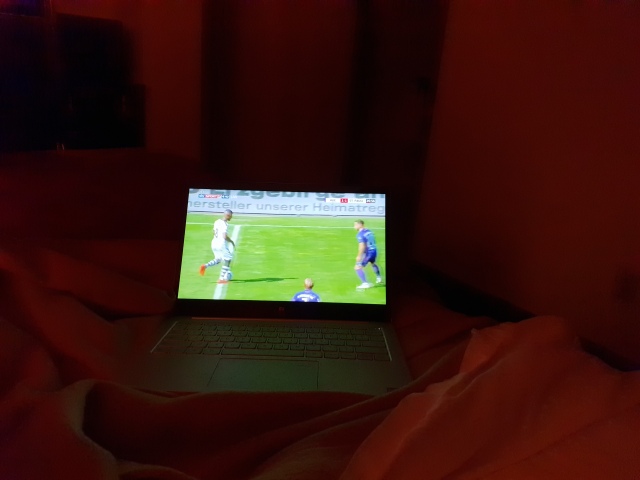Zu den intensivsten Erlebnissen als Fußballfan zählen, das mag in der Natur der Sache liegen, letzte Spieltage. Nicht unbedingt in Deutschland – Bayern München Meister, der magische FC stabil auf irgendwas zwischen 6 und 9, der hsv in Liga 2, das ist jenseits von langweilig und spannend. Vielleicht ein bisschen egal. Wie ohnehin immer empfiehlt es sich also, den Blick zu heben und zu schauen, was denn anderswo so geht.
In diesem konkreten Fall ging mein Blick zunächst nach Italien. Dort stand Juventus zwar früh als Meister vor Neapel fest. Die Plätze dahinter versprachen aber Spannung. Maßgeblich für mich allerdings ein anderer Grund – die sich verdichtenden Gerüchte, in Milan plane man den Abriss des Giuseppe-Meazza-Stadions, von Fans des AC aufgrund der Vereinsvergangenheit des Namensgebers bevorzugt nur nach dem Stadtteil als San Siro bezeichnet. Der Grund dafür sagt viel über die traurige Gegenwart im italienischen Fußball: Für beide Vereine ist San Siro eine Nummer zu groß. Blick auf den Spielplan, Inter am letzten Ligawochenende zuhause, passt.
Blick auf die Karte
Milan als Stadt hat aus der Ferne betrachtet zwei hervorstechende Eigenschaften: Es ist ziemlich teuer und verfügt mit Malpensa über einen erstaunlich abgelegenen Flughafen. Beides Gründe, die ich in meine Reiseplanung einbezog. In der Schweiz nämlich, ebenfalls abgelegen und teuer, wurde auch noch Fußball gespielt. Besonders reizvoll hierbei das Duell des FC Lugano, Kurs Europa, gegen den Rekordmeister Grasshoppers Zürich, schon zum Zeitpunkt meiner Planungen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in Liga 2 abgestiegen. Der fußballerische Aspekt stand also.
Mit einer Ankunft am späten Freitagabend und einem Abflug am frühen Montagmorgen, allerdings ohne Auto und Führerschein, ging es an die Feinarbeit. Letztlich gestaltete sich das alles ganz simpel: Von Malpensa aus mit dem Zug nach Como, am nächsten Tag ebenfalls per Zug nach Lugano. Mangels Verbindungen nach Spielende wiederum am Sonntagmorgen per Bus nach Malpensa, dort per Shuttle zum Flughafenhotel, per Shuttle zurück zum Flughafen, per Zug nach Milan. Mit der Straßenbahn zum Stadion, per Bus zurück zum Hotel, mit dem Flugzeug nach Berlin und per Bus und U-Bahn direkt an den Schreibtisch, um das ganze unterwegs ausgegebene Geld wieder reinzuholen. Nichts leichter als das.
Letztlich also eine Tour wie ein traditionelles italienisches Menü: Viel zu viel in viel zu kurzer Zeit, geht schon ein bisschen ins Geld, voller Highlights und dermaßen gehaltvoll, dass kein vernünftiger Mensch auf die Idee käme, das regelmäßig zu machen. Na, dann mal los.
Antipasti
Como 1907 hatte bedauerlicherweise schon zwei Tage zuvor seine Saison beendet, sodass ich von dem quasi direkt am Stadion gelegenen Hostel insofern nicht profitieren konnte. Dem geneigten Fußballreisenden sei diese Unterkunft jedoch nicht nur wegen ihrer Lage empfohlen – abgesehen von den ansonsten auch in Como brutalen Hotelpreisen würde ich es tatsächlich als das beste Hostel bezeichnen, in dem ich je war. Außerdem verfügt es über eine wunderhübsche Google-Rezension, in der sich der Verfasser intensiv darüber aufregt, dass dieser einstmals herrliche Ort nunmehr ein Treffpunkt für Linksextreme geworden sei. Nach Schweizer Maßstäben könnte es keine größere Empfehlung geben als diese, genau mein Ort also. Werbung für Unterkünfte mache ich hier keine, aber die Hosteldichte in Como ist überschaubar: Es gibt meiner Auffassung nach exakt eines.



Da es keinen Fußball gab, werde ich, der ich mich stets auf den Sport und das Geschehen auf dem Platz beschränke, nichts schreiben über den wunderschönen Comer See, die lombardischen Berglandschaften oder die beeindruckende Aussicht auf Stadt und See vom nahegelegenen Brunate. Ausdrücklich ebenfalls nicht erwähnt seien die Weine oder das Essen (wobei eine dort angebotene Pizzakreation mit Pommes Frites tatsächlich in ganz besonderem Maße nicht erwähnt sein möge; glücklicherweise war es schon Samstag, und samstags isst man offenbar keine Pizza). Mit solchen Profanitäten mögen sich Touristen befassen, ich hingegen wählte aus der verwirrenden Vielfalt lokaler Bahnhöfe den mir passend erscheinenden aus und bestieg den Zug nach Lugano.
Primo Piatto
Gewitter in den Bergen sind eine wirklich beeindruckende Sache. Wunderschön zu betrachten, sofern man sich nicht mittendrin befindet. Weswegen dieser Absatz mit einer solchen Erkenntnis beginnt, dürfte offensichtlich sein.

Ich verbrachte die folgenden zwei Stunden damit, mich abzutrocknen und einen Weg Richtung Stadt zu finden. In Lugano nutzt man hierfür eine eher etwas überflüssige Zahnradbahn, quasi als Pendat der wenige Stunden zuvor gefahrenen Seilbahn von Como nach Brunate. Ich kam mir zunehmend wie ein Verkehrsmittelhopper vor und fragte mich, ob das mit dem Fußball noch mal was werden würde. Immerhin waren die Hotspots der Stadt unmissverständlich markiert.

Auch die Innenstadt war abgesehen von irgendeiner uninteressanten Laufveranstaltung erstaunlich ruhig. Zwar ging ich bereits davon aus, dass nach einer so desolaten Saison nicht allzu viele Grasshoppers-Fans den für lokale Verhältnisse doch recht langen Weg auf sich genommen haben würden. Allerdings hätte ich schon erwartet, dass diese wenigen Fans zumindest pflichtschuldig ein wenig randalieren. Hiervon aber keine Spur, die Stadt gab sich nahezu enttäuschend beschaulich.
Das Stadio di Cornaredo gehört zu jenen Vertretern seiner Zunft, deren Namen ich mir partout nicht merken kann. „Stadion Lugano“ ist einer der Top-Suchbegriffe der letzten Tage auf meinem Handy. Vielleicht wäre hier ein griffiger Sponsorenname angemessen. Schauinsland-Reisen oder Sparkasse Erzgebirge oder so. Gut, Sparkasse Erzgebirge vielleicht nicht. Obwohl sich landschaftlich hier gewisse Gemeinsamkeiten ergeben.

Hübsch, die Lage. Und das Stadion eigentlich auch. Wenngleich man doch verwöhnt ist vom deutschen Fußball und seinen modernen Errungenschaften. Dächern, beispielsweise.

Das Bier irgendwo zwischen alkoholfrei und undefinierbar, sicher bin ich mir bis heute nicht (wobei das beeindruckende Spirituosenangebot eigentlich gegen Ersteres sprechen würde). Der Gästeblock eher mäßig gut gefüllt, fast durchweg schwarz gekleidet, größtenteils sitzend und komplett schweigend. Auf allen Heimtribünen hingegen recht viel Betrieb, der tabellarischen Situation entsprechend.

Mit einem Sieg konnte der FC Lugano heute aus eigener Kraft ein Ticket nach Europa buchen, oder zumindest in jene seltsame Vorhölle namens Euro-League-Qualifikation. Um dann vermutlich gegen einen Vertreter aus Liechtenstein, Aserbaidschan, dem Vatikan, Atlantis oder Taka-Tuka-Land zu scheitern, wie es das Schicksal so vieler Euro-League-Qualifikations-Qualifizierter war und auf ewig sein wird. Platz 3 und damit der direkte Weg nach Kerneuropa allerdings durchaus auch in Reichweite, zumal der dort befindliche FC Luzern zeitgleich beim überragenden Team der Liga in Bern gefordert war.
Soweit zum optimistischen Teil. Der pessimistische, in meinem Klischeebild der Schweiz von jeher der beliebtere, sah wie folgt aus: Da die vier in der Tabelle allesamt auf Schlagdistanz hinter Lugano einsortierten Vereine aus Thun und Sion, Zürich und St. Gallen direkt aufeinandertrafen und also mit einiger Wahrscheinlichkeit jeweils einer von beiden gewinnen würde, konnte man sich ohne eigenen Sieg ganz schnell auf Platz 6 ohne jede Chance auch nur auf Ferner-liefen-Europa wiederfinden. Gleichzeitig vermutete man bei den Grasshoppers nach 20 sieglosen Spielen gewisse Bestrebungen, sich ein wenig zu steigern, um diesmal zumindest nicht schon während des Spiels die Trikots an die eigene Fankurve aushändigen zu müssen.
Alles angerichtet mithin. Theoretisch war noch die Augsburger Discolegende Caiuby für die Zürcher am Start, das beschränkte sich mit Blick auf den Kader dann aber auch auf die Theorie. Ansonsten ein Spiel für Experten, was die Namen angeht. Einzig Grasshoppers-Torwart Heinz Lindner könnte etwaig anwesenden Frankfurtern noch ein vager Begriff sein, ähnlich wie sein Landsmann und Mannschaftskollege Marco Djuricin vor einigen (also vielen) Jahren bei irgendeinem egalen Berliner Verein für, nun, „Furore“ sorgte. Eine Auswahl voriger Vereine der übrigen Spieler: Lorca FC, Gramozi Erseke, FC Koper, Chieti Calcio, FC Le Mont, Zug 94, Slaven Belupo Koprivnica. Nächste Tour steht.
Wie um aller Skepsis entgegenzuwirken, dominierte der Gastgeber von Beginn an Spiel und Gegner fast nach Belieben. Wie um sie zu bestärken, brachte dies jedoch nichts ein. Zwar fuhr Lugano Angriff um Angriff in Richtung des Grasshoppers-Tors, ohne selbst wirklich unter Druck zu geraten. Jedoch erwies sich das Konzept, jeden dieser Angriffe mit einem völlig missglückten Fernschuss abzuschließen, als wenig ertragreich – sofern man zahlreiche Abstöße und teils sogar Einwürfe für den Gegner nicht als Ertrag bewertet. Die Fans des Heimvereins taten dies nicht, im Nieselregen machten sich erste Spuren von Frustration bemerkbar. Dass der FC St. Gallen beim FC Zürich früh in Führung ging, während Luzern bei den Young Boys weiterhin ein Unentschieden hielt, tat sein Übriges. Allen war klar, das konnte ganz schnell kippen.

Stoisch weiterhin die Gästekurve, laut und mit reichlich pyrotechnischen Erzeugnissen gesegnet die heimischen Ultras. Merkwürdig immer noch das Bier, immer nasser der Regen. Die Pause bereits in Sichtweite, lösten die Grasshoppers sich vermehrt aus der Luganer Umklammerung, schienen zu merken, dass da was geht. Verlieren jedoch kurz vor dem Strafraum den Ball, und dann geht es ganz schnell. Der Ball auf der rechten Seite, runter an die Grundlinie, Flanke auf den langen Pfosten, Kopfball, Tor Lugano. Wie eine Erlösung. Dass Tore im Fußball oft nicht aus logischer Konsequenz, also in der eigentlich „passenden“ Phase des Spiels fallen, macht den Fußball aus. Diese Saison gewinne ich allerdings zunehmend den Eindruck, dass die Tore sich inzwischen vollends weigern, in derartigen Druckphasen zu fallen, und sich stattdessen aus purem Trotz rein willkürlich über die Spielzeit verteilen. Zürich jedenfalls hatte sich mit viel Aufwand doch noch ins Spiel reingearbeitet und kassierte als Belohnung diesen Konter. Gleichzeitig verbreitete sich – mit etwas Verzögerung – auch die Nachricht von der Berner Führung. Kurs Platz 3 damit.
Keine lange Freude allerdings. Minute 44, Freistoß für die Grasshoppers aus dem Halbfeld. Die Abwehrreihe des FC Lugano bewegte sich während der Ausführung bereits in Richtung Kabine und bemerkte dabei nicht, dass der Ball noch im eigenen Strafraum lag. Ärgerlich. Abstauber, Ausgleich. Pausenpfiff. Ein bisschen wie eine kalte Dusche, aber so richtig passiert war angesichts der anderen Ergebnisse noch nichts. Bern lag weiterhin in Front, ebenso wie St. Gallen. Zwischen Sion und Thun stand weiterhin die Null. Damit Platz 4 aktuell, immerhin.
Entsprechend wach und engagiert kam Lugano zurück aus der Kabine. Gleich der erste nennenswerte Angriff brachte die erneute Führung: Zürich konnte einen gefährlichen Freistoß nur bis zur Strafraumkante klären, von dort landete die Direktabnahme eines gewissen Mattia Bottani im Eck. Glückwunsch auch an dieser Stelle, hübsches Ding. Noch hübscher wäre kurz danach das 3:1 gewesen. Wenn man von der Mittellinie aus alleine auf den Torwart zuläuft, sind das knapp 50 Meter Dribbling. Läuft man 60 Meter, ist man vermutlich zu weit. Das sieht dann entsprechend etwas dämlich aus. Immerhin, quasi zeitgleich glich der FCZ gegen St. Gallen aus. Wir erinnern uns: Unentschieden sind gut, sofern man nicht selbst betroffen ist. Noch besser das 2:0 der Young Boys, womit Luzern sich schon halb aus dem Rennen um Platz 3 verabschiedete.
Die Grasshoppers entwickelten nun wieder mehr Druck. In Minute 62 fand ein wunderschöner Pass aus dem Halbfeld im vorhin erwähnten Djuricin seinen Abnehmer. Djuricin entschied sich, das zu tun, was er diese Saison offenbar bevorzugt tut: Nicht treffen. Zugegebenermaßen begünstigt durch einen großartigen Reflex des Luganer Torhüters. Ohnehin müßig, denn der Nachschuss fand sein Ziel. Ausgleich. Und weil im Sinne der Dramaturgie alles überall zeitgleich passieren muss, traf der FC Thun auch noch in Sion. Thun in Führung, Unentschieden in Zürich, Luzern hinten, aber punktgleich: Wie die Mathematiker unter uns erfasst haben werden, bedeutete ein weiteres Gegentor für Lugano Platz 6 und damit den… Luxit.
Natürlich fiel es. Und natürlich schoss es Djuricin nunmehr höchstpersönlich, in Minute 70 mit einem vielleicht nicht gänzlich unhaltbaren Fernschuss. Weiterhin stoisch zur Kenntnis genommen vom schweigenden Gästeblock, im Nieselregen von Lugano.
Die Schlussphase, wenige Minuten später. Ein hartes Einsteigen im Mittelfeld gegen einen Luganer. Gelb. Gelb-Rot. 12, 13, 14 Minuten Überzahl und Anrennen. Alles versuchen. Auch der Gästeblock jetzt erwacht, für die letzten 10 Minuten und unter dem Motto „Immer 100 % GC“.

Regen, Pyro, Brechstange. Intensiv. Die Young Boys schießen Luzern ab, egal jetzt. Lugano muss sich selbst helfen. Fünf Minuten auf der Uhr, ein Wechsel noch. Brlek heißt er anscheinend. Kommt im Strafraum an den Ball. Latte. Wirft sich in den Abpraller rein, trifft ihn, drückt ihn irgendwie in den Winkel. Tor. 3:3. Platz 3.
Auch wenn der Schiedsrichter pünktlich abpfeift, Schluss ist noch lange nicht. Ein Konkurrent verbleibt, St. Gallen spielt in Zürich weiterhin um Sieg und Platz 3. Ein ganzes Stadion mit Blick auf das Handy, den Gästeblock mutmaßlich ausgenommen. Die Minuten ziehen sich dahin, irgendwann ist es geschafft. Platzsturm nach Schweizer Art – erst die Tore öffnen lassen, dann mal schauen, dass man sich Richtung Platz begibt. Ich finde mich im Arm eines wildschweinartigen Maskottchens namens Mr. Lug wieder, aber auch das macht den Abend nicht kaputt.

Große Feier im Discozelt hinter der Tribüne, möglicherweise sogar mit Caiuby, vielleicht aber auch nicht.

Ich mache mich auf den Heimweg, schließlich war das erst Teil eins.
Secondo Piatto
Ein viel zu früher Fernbus bringt mich erneut über die Grenze. Ohne dass ich etwas von dieser Grenze merke, am Tag der Europawahl. Wie großartig das ist, würden viele wohl erst bemerken, wenn es wieder anders wäre. Auch sonst klappt erstaunlicherweise alles. Der Bus, die Hotelshuttles, die Gepäckabgabe, merkwürdigerweise sogar schon der Check-In, und schlussendlich der Zug nach Milan.
Gibt mir nicht so wirklich was, die Stadt. Essen und das Eis später ohne Frage super, aber anderenfalls hätte man Milan wohl auch nicht erlaubt, sich als Teil von Italien zu bezeichnen. Der Dom ist sicher auch hübsch, klar. Andererseits laufen überall Massen von Leuten rum, und schon nach recht kurzer Zeit fragt man sich, was die eigentlich alle dort wollen.


Diese Sache mit der Mode, daran glaube ich nicht. Natürlich ist Berlin im Vergleich zu jedem Ort des bislang bekannten Universums eine geradezu unfassbar schlecht gekleidete Stadt, aber wenn Milan eine Modehauptstadt sein soll, gilt das nach erster Anschauung vermutlich für eine Mehrzahl der Orte, in denen sich das zumindest gelegentliche Tragen von Bekleidung kulturell durchgesetzt hat.
Nicht schlimm, man ist ja nicht zum Spaß hier. Über San Siro dürfte alles geschrieben und gesagt sein, was man sagen und schreiben kann. Wer bei FIFA 98 nicht für jedes Duell dieses Stadion ausgewählt hat, hat den Fußball nie geliebt. Und da ich bei Erscheinen dieses Spiels in einem höheren einstelligen Lebensalter war, ist der Einfluss des Giuseppe-Meazza-Stadions auf meine Liebesgeschichte mit dem Fußball ganz erheblich.

Ein bisschen wie eine wuchtige und gleichwohl elegante Mischung aus Schildkröte und Elefant erhebt sich die Arena inmitten eines weitläufigen Betontals, der Oberrang gestützt von den charakteristischen Treppentürmen. Ein Stadion wie ein Mercedesstern – man muss weder mögen, wie es aussieht, noch, für wen es steht, aber wiedererkennen wird man es unweigerlich. Genau jene Art von Stadion also, die zunehmend verdrängt wird von komfortablen Zweckbauten diverser Maßkonfektionsanbieter einerseits und absurden Milliardärsträumen wie etwa jüngst in Tottenham andererseits. Allmählich mache ich mir Sorgen, noch zum Fußballromantiker zu werden. Erst das nasse, großartige, dreckige Unentschieden von Lugano und jetzt solche Gedanken.

Gut was los rund um das Rund. Zwar heißt der Gegner bloß Empoli, es geht aber für Inter noch um die Champions League. Reizvoller noch – die Konkurrenten um die verbleibenden Qualifikationsplätze heißen Atalanta Bergamo und AC Milan. Gegen die direkten Nachbarn gewinnt man eben besonders gerne, und sei es auch nur indirekt.

Bekannt war mir über Inters Fanszene bis dato nur, dass die Ultras dort eine gewisse Affinität zum Heben ihres rechten Armes zeigen – zwar nicht derart intensiv wie beim Paradebeispiel SS Lazio, aber durchaus ambitioniert und mit guten Kontakten auch Richtung Rom. Ich entschied mich daher, einen Platz in etwa 120 Meter Entfernung von den Ultras zu wählen. Dabei vergaß ich blöderweise, dass dieser Platz nun in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gästeblock lag und dass derartige Bereiche des Stadions europaweit traditionell von einer ganz anderen, ebenfalls nicht zwingend angenehmen Gruppierung frequentiert werden.

Unter den Althooligans von Milan sind Keltenkreuze ein beliebtes wie verbreitetes Motiv, ich selbst hatte leider ausnahmsweise keine passende Oberbekleidung dabei. Mir schien daher insgesamt eine gewisse Zurückhaltung geboten. Von dem vagen Plan, eventuell den Gegner aus Empoli ein klein wenig anzufeuern, nahm ich gedanklich Abstand. Sogar die bereitgestellte Klatschpappe faltete ich vorschriftsgemäß zurecht, ohne zu intensiv darüber nachzudenken, ob ich in meinem Fanleben bereits mit faschistisch vorgebildeten klatschpappenschwingenden Althools konfrontiert war und wenn ja, wie die optimale Strategie für die kommenden rund 105 Minuten wohl aussähe.

Ich entschied, mich auf das Spiel zu konzentrieren und energisch jedem Blick auszuweichen, der mir begegnete. Gab schließlich auch genügend Anlass hierzu. Für Empoli ging es um den Klassenerhalt, man musste entweder auf den ebenfalls noch nicht geretteten AC Florenz und seinen Sieg gegen den CFC Genua im Parallelspiel hoffen oder aber angesichts des schwächeren Torverhältnisses zumindest einen Punkt beim großen Favoriten Inter holen. Inter hingegen brauchte einen Sieg, um sicher in der Champions League zu sein. Schon bei einem Unentschieden wäre man auf Schützenhilfe von SPAL Ferrara gegen den AC Milan sowie von Sassuolo gegen Bergamo angewiesen gewesen – auf zwei Vereine also, für die es um nichts mehr ging. Auch vom AS Rom ging noch zumindest theoretische Gefahr aus. Empoli war dabei nicht zu unterschätzen, zeigte die Formkurve dort doch ganz im Gegensatz zur eigenen steil nach oben.
Auf dem Feld fand sich ein wenig mehr Prominenz als zuvor in Lugano. Namen wie de Vrij, Nainggolan, Perisic oder Icardi mag man schon das eine oder andere Mal zuvor gehört haben. Aufseiten des magischen FC gab es der Vollständigkeit halber noch die Anwesenheit von Jacob Rasmussen zu vermelden, der für den FC Empoli die Ersatzbank hütete. Inter-Trainer Luciano Spalletti gelang es im hervorragend geschnittenen Anzug doch noch, den Ruf der Modestadt Milano bei mir zu retten, während sein Amtskollege bodenständige Funktionsbekleidung bevorzugte. Abstiegskampf halt. Ähnlich gestaltete sich auch das Spiel selbst.

Unter den Augen von diesmal ausnahmsweise knapp 70.000 Fans begann Inter erwartungsgemäß stark. Empoli konnte den Angriffen der Gastgeber wenig entgegensetzen, abgesehen von einem zeitweise fast unverschämten Maß an Glück und engagiertem Zeitspiel insbesondere ihres im Übrigen starken Torhüters – durchaus zum Missfallen der um mich herum verteilten Sympathie- und Keltenkreuzträger. Die Klatschpappen bebten vor Zorn. Um die 30. Minute kam tatsächlich auch Empoli zu einer etwas größeren Gelegenheit, jedoch letztlich ohne größere Mühen vereitelt durch Inters Torhüter Handanovic.
Der Ausdruck „vaffanculo“, auf eine Übersetzung verzichte ich an dieser Stelle, besitzt ohnehin eine erhebliche Prominenz im italienischen Fußball (wie auch in der italienischsprachigen Schweiz, lernte ich am Vortag). Hier schien er mir die gesamte erste Hälfte aus Sicht der Interisti erschöpfend zu beschreiben, insbesondere die in der Tat etwas erstaunliche Entscheidung, diese pünktlich zu beenden. Teilerfolg für den Trainingsanzugfußball. Begleitet allerdings vom Gefühl, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis Inter in Führung geht, und die einzige Hoffnung von Empoli darin liegen dürfte, dass ebenjene Zeit im Fußball glücklicherweise sehr klar begrenzt ist. Allerdings, sie mussten. Der AC Milan lag bei SPAL knapp in Führung, und Bergamo war bereits zur Halbzeit beim Stand von 1:1 gegen Sassuolo in Überzahl.
Kurz nach Wiederanpfiff war es dann so weit. Baldé konnte sich in zentraler Position aus rund 22 Metern vor dem Tor von Empoli ein Bier aufmachen, einen Liegestuhl aufbauen, auf dem Handy die Zwischenstände von den anderen Plätzen überprüfen, feststellen, dass ein Tor hilfreich wäre, und ebenjenes sodann schießen. Sprich: Ein wenig mehr Druck von der Abwehr wäre an dieser Stelle wohl durchaus anzuraten gewesen. So forderte man das bereits reichlich bemühte Spielglück doch zu sehr heraus. Verdient natürlich, die Führung von Inter, aber dennoch ärgerlich. Meinen Ärger nicht zu zeigen, bemühte ich mich aus bereits benannten Gründen. Offenbar erfolgreich, immerhin bin ich in der Verfassung, diesen Text zu schreiben. Baldé wiederum schien sich über seinen Treffer wirklich sehr zu freuen, entledigte er sich doch seines Trikots und sah dafür Gelb.
Kurz nach dem Führungstreffer sah sich ein Empoli-Verteidiger veranlasst, einen eher mäßigen Rückpass auf den eigenen Torwart zu spielen, dessen Mäßigkeit sich darin äußerte, dass er fast auf dem Fuß des in den Strafraum startenden Icardi landete. Aus meiner Sicht nicht restlos aufzuklären ist, ob er durch den Torhüter oder durch Selbstzweifel zu Fall gebracht wurde, das Ergebnis jedenfalls war ein Strafstoß für Inter. Nach längerem Videostudium war das Ergebnis ein Strafstoß für Inter. Inter bekam also einen Strafstoß und bekam den Strafstoß erneut nach gefühlten fünf Minuten. Schöne neue Welt.

Aus Protest gegen sich selbst verschoss Icardi dementsprechend. Oder, wäre man ihm wohlgesonnen: Scheiterte am Torhüter.
Empoli gelang es in der Folge, tatsächlich so etwas wie Druck aufzubauen, wobei dieser Begriff angesichts der spielerischen Möglichkeiten das Hinzudenken von Anführungszeichen erfordert. In Minute 70 gelang es bereits einem Angreifer fast, Handanovic zu umkurven und zum Ausgleich einzuschieben. Kurz darauf war es dann soweit: Schnelle Ballstafette auf der rechten Angriffsseite, Ball kommt an der Grundlinie in den Strafraum von Inter. Der Flachpass in die Mitte sitzt perfekt im Rücken der Abwehr, und frei vor dem leeren Tor bleibt Traore aus zwei Metern und dreieinhalb Zentimetern Distanz wenig anderes übrig, als zu treffen. Also, das Tor. Auch er überlegte zunächst offenkundig, sich seines Trikots zu entledigen, ließ dies aber dann doch bleiben und wurde folgerichtig anders als Baldé nicht verwarnt.
Wieder alles offen also, und Inter in Nöten. Entsprechend investierten sie ab diesem Zeitpunkt viel mehr in das eigene Offensivspiel, und wieder war das Gefühl greifbar, dass hier unweigerlich ein weiterer Treffer für die Gastgeber fallen würde. So kam es auch. Vecino traf mit seinem Versuch in Minute 81 zwar nur den Pfosten, aber dem völlig frei stehenden Nainggolan bereitete es keinerlei Mühe, den Abpraller zur erneuten Führung zu verwerten.
Kurz vor Ablauf der Uhr standen plötzlich gleich vier Spieler der Gäste völlig frei vor dem Tor von Handanovic. Den Pass in die Mitte konnte allerdings ein Inter-Verteidiger souverän per Grätsche an die eigene Torlatte klären. Um mich herum bemerkte ich allmählich leichte Besorgnis und wahrte mit Mühe einen neutralen bis beunruhigten Gesichtsausdruck. Die soeben beschriebene Szene nämlich bildete den Einstieg in eine noch spektakulärere Schlussphase.
Einen ersten Beliebtheitspunkt bei den Heimfans und der Fraktion Keltenkreuz verdiente sich der – fairerweise gesagt tatsächlich etwas unglücklich agierende – Schiedsrichter, indem er nach dem frühzeitigen Abpfiff beim Stand von 0:0 in Hälfte eins nunmehr volle fünf Minuten Nachspielzeit anzeigen ließ. Natürlich spielte dies ausschließlich Empoli in die Karten, war die Höhe des Siegs für Inter doch völlig egal und kam es doch nur noch darauf an, nicht mehr den Ausgleich zu kassieren. Das war der Mannschaft offenbar sehr bewusst, so unsicher, wie sie in den letzten Minuten agierte.
Schon in der ersten Minute der Nachspielzeit kam Empoli zu einer weiteren großen Möglichkeit, Handanovic rettete Inter erneut. Nach einer Ecke für die Gäste in Minute 94 allerdings war es dann doch ein Konter der Mailänder, der die scheinbare Entscheidung bringen sollte – war doch der gegnerische Torwart mit aufgerückt und liefen also drei Nerazzurri auf einen einsamen Verteidiger und das leere Tor zu. Einer dieser drei traf von der Mittellinie zum entscheidenden 3:1, der Schiedsrichter beendete das Spiel, ohne erneut anzupfeifen. Irgendjemand auf der Bank von Empoli sah zwischendurch auch noch Rot, vermutlich aus Gründen. Schluss also, Abstieg.
Scheinbar.

Moderne Zeiten, wie gesagt. Wo auch immer das Köln Italiens liegt, in den dortigen Räumlichkeiten hatte jemand etwas bemerkt. Das Etwas war der dritte Inter-Angreifer, der Schütze des 1:0 Keita Baldé, der nicht bloß gemeinsam mit seinen beiden Mannschaftskollegen auf das leere Tor der Gäste zulief, sondern dabei auch noch unter intensivem Einsatz seiner Hände den gegnerischen Torwart zu einer Diskussion über Sieg und Niederlage überreden wollte. Hierfür sieht das Regelwerk in derartigen Spielsituationen eine Verwarnung vor.
Ist man schon verwarnt, etwa weil man im Jubel sein Trikot ausgezogen hat, sind wiederum andere Konsequenzen vorgesehen. So auch in diesem Fall für Baldé. Statt 3:1 und Abpfiff also 2:1, Platzverweis und Freistoß für Empoli inmitten der gegnerischen Hälfte. Wäre zu diesem Zeitpunkt zufällig geplant gewesen, Monsieur Louis Le Prince, den Erfinder der Filmkamera, nach Abpfiff im Mittelkreis des Giuseppe-Meazza-Stadions mit einem Nobelpreis zu ehren, hätte in diesem Moment angesichts der leicht irritierten Stimmungslage unter den Keltenkreuzträgern hiervon abzuraten sein müssen.
8 Minuten über der Zeit brachte Empoli den Ball noch einmal in Inters Strafraum. Wieder rechte Strafraumseite, wieder der flache Pass von der Grundlinie in die Mitte – ins Leere. Eine Flanke, ein Kopfball und – Handanovic. Keine Pointe. Schluss, diesmal wirklich. Weil sich Florenz und Genua derweil auf ein 0:0 geeinigt hatten, das beiden reichte, war am Ende also doch Empoli der Verlierer und Inter der große Gewinner dieses Spieltags. Nicht jedes Drama bekommt das Ende, das es verdient. Der Sieg von Bergamo spielte am Ende für Inter ebensowenig eine Rolle wie das 3:2 des Stadtrivalen bei SPAL. Platz 4 als Resultat, den AC Milan in die Euro League verdrängt, das reichte.
Dolce
Mir blieb nicht viel Zeit, hierüber vertieft nachzudenken, musste ich doch den letzten Bus zum Flughafen Malpensa erreichen, um dort in das letzte Hotelshuttle umzusteigen. Wenn man Reisen derart ambitioniert plant, schleichen sich Nachlässigkeiten meist auf den letzten Metern ein, wie ich erst kürzlich auf der falschen Seite eines geschlossenen Gates am Flughafen von Barcelona feststellen durfte.
Ein eleganter Weg, um Sonderzüge und die damit verbundenen Umständlichkeiten zu vermeiden, ist es, die Stadionbahnhöfe einfach unmittelbar nach Spielende zu schließen. Hatte ich bei der Anfahrt noch vermutet, die entsprechenden Ankündigungen falsch übersetzt zu haben, musste ich nun einsehen, dass mein Italienisch immer noch besser ist als gedacht. Das Verkehrskonzept funktionierte in gewisser Weise – ein zweieinhalb Kilometer langer Fußweg entzerrt ordentlich, ganz im darwinschen Sinne. Immerhin wurde ich so auch diverse Keltenkreuze los.
Schlussendlich klappte auch das irgendwie alles, zu meinem eigenen Erstaunen und trotz des völlig überraschend gigantischen Staus auf der Autobahn ins Umland. Viele Verkehrsmittel, drei Städte, zwei Spiele. Zweimal Europa gesichert, zweimal abgestiegen. Bisschen Nieselregen, bisschen Drama. Ist schon mehr los, anderswo. /juli